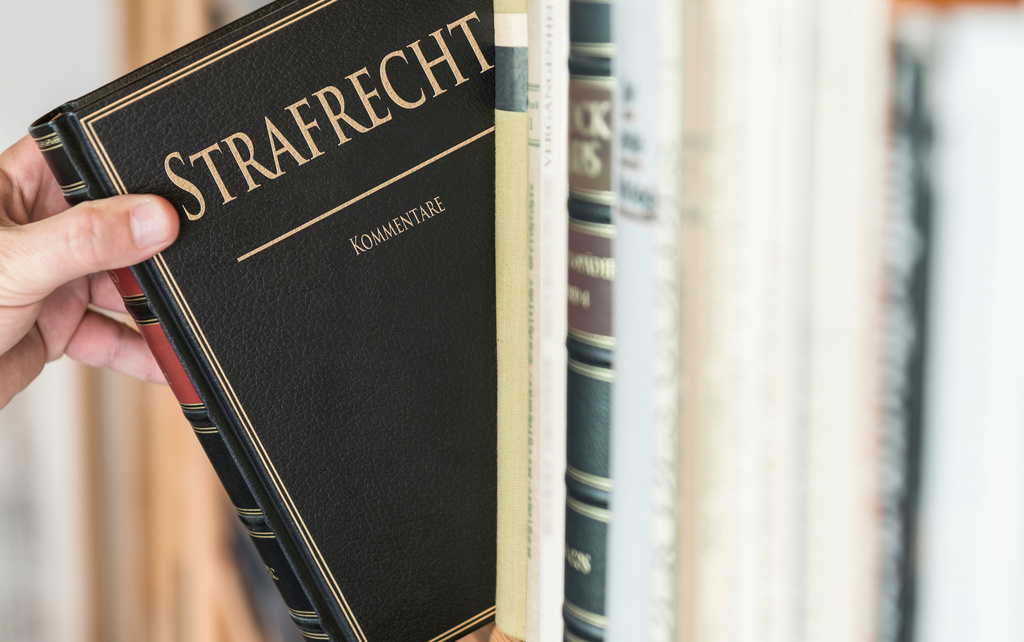Wichtig bei einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren ist, dass der/die Angeschuldigte keine voreiligen Angaben zur Sache unterbreitet. Zu beachten ist, dass die Polizeibeamten, welche entsprechende Ermittlungen führen, gewissermaßen der verlängerte Arm der jeweiligen Staatsanwaltschaft sind. Ich rate regelmäßig an, im Ermittlungsverfahren grundsätzlich keine Angaben zur Sache zu unterbreiten, bevor nicht zumindest der jeweilige Strafverteidiger Akteneinsicht genommen hat.
Der Strafverteidiger wird prüfen, inwieweit darauf gesetzt werden kann, dass das Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachts, § 170 II StPO oder aber etwa wegen Geringfügigkeit, ggf. gegen Auflage eingestellt wird, §§ 153, 153 a StPO.
Ein aggressives Auftreten der vernehmenden Polizeibeamten ist nicht selten anzutreffen. Oft kommt es im Gegenteil aber auch zu geradezu „süßlichen“ Einladungen der Vernehmungspersonen, sich doch mal eben rasch zur Sache zu äußern, es werde schon nicht so schlimm werden („des wird fai eh eigstellt“). Jeder Angeschuldigte sollte hier von seinem gesetzlich fundierten Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. In einem strafgerichtlichen Verfahren darf es kein Urteil geben, in welchem es heißen würde, dass ein Angeklagter als überführt gilt, weil er geschwiegen hat. Ein solches Urteil wäre sofort „revisibel“, verkürzt gesprochen über eine höhere Instanz anfechtbar. In der Tat gibt es nicht selten Sachverhaltskonstellationen, im Rahmen derer ich der eigenen Mandantschaft anrate, sich während des gesamten strafrechtlichen Verfahrens nicht zur Sache zu äußern.
Wichtig ist auch, dass sich ein/e Angeschuldigte/r durch Vernehmungspersonen, etwa durch Polizeibeamte nicht einschüchtern lässt. Das Gesetz sieht vor, dass ein jeder Angeschuldigter vor einer Beschuldigtenvernehmung darüber zu belehren ist, sich zur Sache ggf. nicht äußern zu müssen und ggf. eine/n StrafverteidigerIn beizuziehen. Seltsamerweise wird diese Belehrung hier und da von Vernehmungspersonen „übersprungen“.
Wie heißt es so schön? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Dies gilt insbesondere im Bereich einer beabsichtigten Beschuldigtenvernehmung.
Eine Einlassung zur Sache sollte wenn, dann nur über eine/n StrafverteidigerIn erfolgen, welche/r zuvor die Akte der Staatsanwaltschaft - oder eben, je nach Verfahrensstadium - des Gerichts eingesehen hat. Ohne Akteneinsicht weiß der Strafverteidiger eben schlichtweg weniger, als die Ermittlungsbehörde. Dieses Ungleichgewicht muss zunächst durch Akteneinsicht behoben werden.
Von meiner Seite aus soll der Beruf des Polizeibeamten bitte nicht mit einer Silbe kritisiert werden. Die Mehrheit der Polizeibeamten, mit welchen ich in meinen 25 Berufsjahren zu tun hatte, verhält sich vollkommen korrekt. Wie bei Strafverteidigern, gibt es eben auch bei Polizeibeamten Ausnahmen, welche mit einem rabiaten Auftreten nicht selten die Angeschuldigten einzuschüchtern versuchen. Sanktionen können Polizeibeamte im Übrigen nur in minimalem Umfang verhängen. Die Frage der strafrechtlichen Sanktionen ist stets ureigene Aufgabe des Gerichts, nicht eines Polizeibeamten. Auch der Hinweis, dass man „verhaftet“ werde, wenn man sich jetzt nicht äußert, soll eine/n BürgerIn bitte nicht einschüchtern. Ein Polizeibeamter kann überhaupt nicht verhaften, allenfalls vorläufig festnehmen (und dies auch nur unter strengen gesetzlich vorgegebenen Voraussetzungen, § 127 StPO). Eine Verhaftung kann nur durch den Haftrichter angeordnet werden.
Wenn also gegen einen Bürger ermittelt wird, gilt zunächst der Grundsatz „Ruhe bewahren“ und nicht auf ein schnelles Ergebnis hoffen.